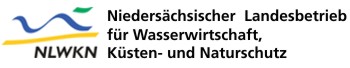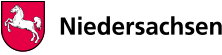Folgen des Klimawandels
Die Gewässerunterhaltung steht vor neuen Herausforderungen
Von Merle Sandkühler und Jörn Drosten
Der Klimawandel ist schon länger keine abstrakte Zukunftsfrage mehr – denn die Folgen sind bereits heute spürbar, insbesondere in der Pflege und Entwicklung der landeseigenen Gewässer. So steht die Gewässerunterhaltung schon jetzt vor zahlreichen, neuen Herausforderungen. Die Arbeitsgruppe Ökologische Gewässerunterhaltung des NLWKN hat bereits 2023 einen Überblick über die bisher zu beobachtenden Auswirkungen im Bereich der Gewässer- und Anlagenunterhaltung erarbeitet. Diese haben sich bereits in den letzten Jahren sehr vielfältig bemerkbar gemacht.
Veränderte Abflussdynamik
Der Klimawandel verändert die Abflussdynamik in Gewässern: Es treten immer häufiger extreme Hoch- und Niedrigwasserereignisse auf.
Durch diese zunehmenden Schwankungen können Unterhaltungsarbeiten immer schlechter geplant werden. Zudem müssen die Verantwortlichen des NLWKN ein immer größeres Abfluss-Spektrum berücksichtigen und das oft zeitgleich: Aufgrund der steigenden Starkregengefahr ist daher auch in Niedrigwasserzeiten ein ausreichendes Abflussprofil zu gewährleisten.
Der Winter 2023/2024 hat zudem gezeigt, dass das Risiko von sich zeitlich überlagernden Hochwasserereignissen in verschiedenen Einzugsgebieten und gleichzeitigen Sturmfluten steigt. Dies erfordert eine besonders vorausschauende Steuerung der Bauwerke sowohl in den Schutzdeichsystemen an der Schnittstelle zwischen Küsten- und Binnenbereich, also der landeseigenen Sperrwerke, als auch bei der Steuerung und Bedienung von Wehranlagen und Schöpfwerken im Binnenbereich. So kann es vor allem bei der Anlagenbedienung und -überwachung zu problematischen Personalengpässen kommen.
Klimastress für heimische Pflanzen und Tiere
Die Veränderungen im Klima setzen auch den heimischen Wasser- und Uferpflanzen zu. Höhere Temperaturen und längere Trockenphasen führen bei vielen Pflanzenarten zu Stress. Besonders problematisch sind beispielsweise vertrocknete Grasnarben auf Deichen und Dämmen. Sie drohen ihre unverzichtbare Schutzfunktion als ingenieurbiologische Elemente der technischen Bauwerke zu verlieren und die Gefahr von Erosion zu erhöhen. Andererseits verlängert sich die Vegetationsperiode, wodurch Mäharbeiten über immer längere Zeiträume erforderlich werden – mit steigendem Arbeitsbedarf. Besonders bemerkbar machen sich die Auswirkungen auch bei Gehölzen. So sterben vor allem neu gepflanzte Bäume schnell ab oder benötigen deutlich mehr Pflege.
Der Klimawandel fördert zudem die Ausbreitung invasiver Pflanzenarten, wie Herkulesstaude und Wassernabel, die wiederum im Rahmen der Unterhaltung mit meist deutlich erhöhtem Aufwand bekämpft werden müssen.
Auch für aquatische Lebewesen wie Fische ist der Klimawandel lebensbedrohlich. Ausgeprägte Niedrigwasserphasen mit hohen Wassertemperaturen teils noch in Verbindung mit Schadstoffeinträgen bei Starkregenereignissen steigern das Risiko von Fischsterben.
Kein Frost im Winter und kein Wasser im Sommer
Früher richteten sich viele Unterhaltungsmaßnahmen nach den jahreszeitlichen Witterungsbedingungen, und es wurde sich nach Möglichkeit natürlicher Abläufe bedient. Durch den Klimawandel gibt es bereits jetzt kaum noch ausgeprägte Frostperioden, um Gehölze verlässlich, auch in Gewässernähe und bei wenig tragfähigen Böden, erreichen und pflegen zu können.
Problematisch wird es auch bei Niedrigwasser im Sommer: Wenn in Fließgewässern eine Krautung, erforderlich ist, wird das abgetriebene Schnittgut meist an sogenannten Krautbäumen gesammelt und dort entnommen. In Niedrigwasserzeiten fehlt jedoch die notwendige Strömung.
Darüber hinaus erfordert extreme Hitze, zum Schutz der Beschäftigten körperlich anstrengende Arbeiten zu verschieben oder zu reduzieren, was die organisatorische Leistungsfähigkeit und die Flexibilität beeinträchtigt.
Steigende Anforderungen an den Anlagenbetrieb
An staugeregelten Gewässern wird die Steuerung von Wehranlagen bei Niedrigwasser zunehmend schwierig. Die Forderung nach mehr Wasserrückhalt kollidiert oft mit bestehenden wasserrechtlichen Vorgaben und den Zielen der Gewässerbewirtschaftung.
Auch die Planung von Neubauvorhaben wird komplexer: Die veränderten Abflüsse erschweren die Dimensionierung von Hochwasserschutz- und Fischaufstiegsanlagen.
Naturnahe Gewässer als Schlüssel zur Resilienz
Eine der wichtigsten Maßnahmen, um die negativen Folgen des Klimawandels abzupuffern, ist die Entwicklung naturnaher Gewässerstrukturen. Naturnahe Gewässer mit funktionierenden Auen sind widerstandsfähiger gegenüber den Auswirkungen von Extremwetterereignissen und tragen zur Stabilisierung des Wasserhaushalts bei – und bedürfen dabei kaum Unterhaltungstätigkeiten.
Die meisten landeseigenen Gewässer sind jedoch stark ausgebaut, was die Gewässerunterhaltung deutlich teurer und personalintensiver macht. Der NLWKN muss daher zunehmend höhere Ressourcen aufwenden, um den Folgen des Klimawandels zu begegnen.