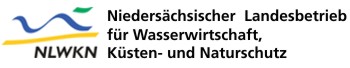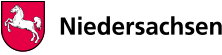Gezielte Beratung: Weniger Nitrat im Grundwasser
Presseinformation vom 16. Juni 2010 // Wasserwirtschaft und Landwirtschaft ziehen in Niedersachsen an einem Strang
Großes Interesse am 15. Grundwasser-Workshop des NLWKN: Es gab einen regelrechten Ansturm bei den Anmeldungen, am 16. Juni konnten in Cloppenburg nur 180 Gäste dabei sein. Der Schutz des Grundwassers und damit des Trinkwassers stand im Mittelpunkt der Tagung. Das anspruchsvolle und gleichermaßen interessante Programm widmete sich den Fragen der praktischen Umsetzung der Projekte zum Schutz des Trinkwassers in Niedersachsen. Die zentrale Frage: Welche konkreten Erfolge sind bei der Reduzierung der Stickstoffüberschüsse erzielt worden?
Nitrat im Grundwasser ist nach wie vor ein Problem: Der aktuelle Nitratbericht der Bundesregierung geht bundesweit von einem sogenannten Bilanzüberschuss von rund 70 kg Stickstoff pro Hektar aus – also die Menge an Dünger, die nicht von den Pflanzen aufgenommen wird und damit im Grundwasser und in den Flüssen landen kann. Niedersachsen gehört wegen der intensiven Viehhaltung mit zu den Spitzenreitern in Deutschland. Deshalb hat die Landesregierung die Landwirte mit ins Boot geholt: „Durch eine gezielte Fachberatung sowie durch freiwillige Vereinbarungen zum Gewässerschutz wurden die Bilanzüberschüsse von mehr als 100 kg N/ha auf bis zu 60 kg abgesenkt“, sagte am Mittwoch Mathias Eberle aus dem Niedersächsischen Umweltministerium anlässlich des Grundwasser-Workshops vor Journalisten in Cloppenburg.
Seit 1992 gibt es in Niedersachsen die Trinkwasserschutzkooperationen; die Beratung der Landwirte steht dabei im Mittelpunkt. „Nach fast 20 Jahren können wir feststellen, dass Wasserwirtschaft und Landwirtschaft gemeinsam und vertrauensvoll beim Trinkwasserschutz zusammenwirken“, sagte Eberle. Folgerichtig habe das Land Niedersachsen schon 2007 den Akteuren vor Ort – also den Landwirten und den Wasserversorgern – mehr Eigenständigkeit bei der Umsetzung der Projekte eingeräumt und damit auch mehr Verantwortung übertragen.
Aus Mitteln der Wasserentnahmegebühr erhalten die Versorgungsunternehmen eine auf fünf Jahre angelegte Finanzhilfe, wenn sie für ihre Kooperation ein Schutzkonzept vorlegen: „Die Wasserversorgungsunternehmen und die Landwirte müssen ganz konkret ihre Ziele zum Trinkwasserschutz festlegen und die Erfolge nachweisen“, betonte Eberle. Jährlich stellt das Umweltministerium hierfür rund 18 Millionen Euro an Fördermitteln bereit. Darin enthalten sind neben den Beratungsleistungen auch Ausgleichszahlungen für vereinbarte Einschränkungen in der Bewirtschaftung.
Und die Landwirte sind zunehmend bereit, ihren Beitrag zum Trinkwasserschutz zu leisten, ergänzte Stephan-Robert Heinrich vom NLWKN in Norden: „Wir haben 14.000 Verträge mit Landwirten abgeschlossen, die ihre Ländereien in den Trinkwassergewinnungsgebieten so bewirtschaften, dass es dem Grundwasser nicht schadet.“. 200.000 Hektar sind damit abgedeckt, das sind zwei Drittel der Flächen in Trinkwasserschutzgebieten. Die freiwilligen Vereinbarungen zeigen Wirkung: „Sie haben 2008 zu einer durchschnittlichen Absenkung des herbstlichen Stickstoffgehalts im Boden von etwa 20 kg pro Hektar geführt“, sagte Martin Windhaus vom NLWKN in Cloppenburg, der die gute Zusammenarbeit mit den Landwirten vor Ort betonte.
Niedersachsen denkt weiter: „Wir bringen Modell- und Pilotprojekte voran, um eine auf den Grundwasserschutz ausgerichtete Landwirtschaft zu stärken“, erläuterte Hubertus Schültken vom NLWKN. Damit sollen verschiedene Möglichkeiten für die Optimierung der Flächenbewirtschaftung im Hinblick auf den Grundwasserschutz beispielhaft untersucht werden. „Natürlich greifen die Projekte auch aktuelle Entwicklungen in der Landwirtschaft auf“. Als Beispiel nannte Schültken den Anbau von sogenannten Energiepflanzen für die Biomasseproduktion. Niedersachsen sei das Bundesland mit den meisten Biogasanlagen. Bis 2010 werden 1.000 Anlagen erwartet. „Um diese Anlagen zu füttern, wird eine Maisanbaufläche von bis zu 200.000 Hektar gebraucht. Derzeit sind es 142.000 Hektar. Und der Mais macht vor den Trinkwassergewinnungsgebieten nicht Halt“.
Das Problem: Der Anbau von Mais verursacht bei der gängigen Düngepraxis deutlich höhere Nitratausträge in das Grundwasser als z.B. der Getreideanbau. Von 2003 bis 2007 wurden in Niedersachsen rund 50.000 Hektar Grünland umgebrochen, um Mais anbauen zu können. „Wir können den Anbau von Mais nicht verhindern, aber unsere Modellprojekte können Anbaumethoden aufzeigen, die das Grundwasser schonen“.
Der Grundwasser-Workshop ist seit 1996 in der Wasserwirtschaft in Niedersachsen etabliert und trifft auch über die Landesgrenzen hinaus auf großes Interesse: „Die traditionelle Veranstaltung bietet den unterschiedlichen Fachleuten der Wasserwirtschaft und den am Niedersächsischen Kooperationsmodell zum Trinkwasserschutz Beteiligten ein landesweites Forum für den fachlichen Austausch zum Trink- und Grundwasserschutz in Niedersachsen“, sagte Stephan-Robert Heinrich aus der Direktion des NLWKN.

Artikel-Informationen
erstellt am:
16.06.2010