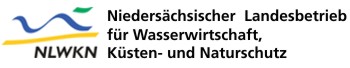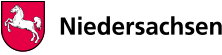Bildrechte: NLWKN
Bildrechte: NLWKNNiedersachsen treibt die Entwicklung von Fließgewässern und Auen voran
Vorstellung des NLWKN-Jahresberichts in Hannover // Neues Kompetenzzentrum bündelt Landesaktivitäten // Natürliche Gewässerlandschaften bewähren sich bei Hochwasserlagen // Vergangener März mit +2,4 Grad über Durchschnitt wärmster in Europa
Hannover – Mit der Gründung eines Kompetenzzentrums für die Entwicklung Niedersächsischer Gewässerlandschaften (KEG) stärkt und konzentriert der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) seine Aufgaben rund um naturnähere Fließgewässer. „Wir bündeln interdisziplinär und für alle Beteiligten sichtbar die Aktivitäten, um Gewässer und Auen naturnah zu entwickeln“, erklärte Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer am Donnerstag (10.04.) bei der Vorstellung des NLWKN-Jahresberichts in Hannover. Mit mehreren 2024 umgesetzten Renaturierungsprojekten und einer Studie zur Wirksamkeit bereits umgesetzter Maßnahmen bildete die Rückkehr zu naturnahen Gewässerstrukturen einen Schwerpunkt im Jahresbericht des Landesbetriebs.
Aber auch die derzeitige Trockenheit nahm der Minister in den Blick: „Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes war der vergangene Monat rekordverdächtig trocken. Er war mit +2,4 Grad über dem Durchschnitt der wärmste März in Europa seit Aufzeichnungsbeginn. Das führt uns nochmal drastisch vor Augen: Die Klimakrise ist in Niedersachsen angekommen“, so Meyer. Mit einem Durchschnittsmittel von nur 21 Prozent des Niederschlags im Vergleich zur Periode 1991 bis 2020 war es extrem trocken. Und: „Noch nie hat es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen weniger geregnet als im März 2025“, so der Minister, „bundesweit gehörte Niedersachsen damit zu den niederschlagsärmsten Regionen. Auch diesen leider weiter zunehmenden Trend zu mehr Dürre und Trockenheit müssen wir mitdenken, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie wir unsere Gewässer künftig bestmöglich weiterentwickeln und schützen können.“
Triebfeder der niedersächsischen Bemühungen sind dabei auch die europarechtlichen Ziele aus der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und den beiden Natura 2000-Richtlinien (FFH- und Vogelschutzrichtlinie). Diese fordern „einen guten ökologischen Zustand“ von Bächen, Flüssen und Seen sowie den Schutz, Erhalt und die Entwicklung von gefährdeten gewässer- und auentypischen Arten und Lebensräumen. Dabei bilden Gewässer und ihre Auen eine ökologische Einheit: „Gewässer brauchen ihre natürlichen Entwicklungsräume und Überschwemmungsgebiete in den Auen – die Auen wiederum sind von den Gewässern und deren Zustand abhängig. Sind diese Zusammenhänge gestört, wird das für viele Tier- und Pflanzenarten zu einem lebensbedrohlichen Problem“, so Umweltminister Meyer. In der Folge sind mittlerweile zahlreiche Arten dieser Lebensräume und die Lebensräume selbst gefährdet.
Dass Bemühungen um eine Trendumkehr dabei durchaus auch mit den Zielen des Hochwasserschutzes und damit der Europäischen Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL) zusammenspielen, die mit dem Klimawandel dringender werden und sich verstärken, unterstreicht Anne Rickmeyer, Direktorin des NLWKN: „Darum haben wir bereits vor Jahren das Aktionsprogramm Niedersächsische Gewässerlandschaften, ein von der Naturschutz- und Wasserwirtschaftsverwaltung gemeinsam getragener Handlungsrahmen, ins Leben gerufen. Mit dem KEG entsteht nun eine Schnittstelle für landesweite, strategische Themen, die alle relevanten Stellen und insbesondere natürlich die Vorhabenträger wie beispielsweise Unterhaltungsverbände und Kommunen zusammenbringt und bei der Umsetzung von Vorhaben aktiv unterstützen soll.“
Nur drei Prozent der Gewässer in gutem Zustand
Der Handlungsbedarf ist groß: Bislang sind lediglich drei Prozent der niedersächsischen Gewässer im geforderten „guten ökologischen Zustand“ nach den Vorgaben der WRRL. Das Land selbst, vertreten durch den NLWKN, unterhält nur einen kleinen Teil der niedersächsischen Gewässer – rund 1.100 Gewässerkilometer insgesamt. „Auch hier ist die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen der WRRL eine echte Herkulesaufgabe“, betont Jörn Drosten, in der NLWKN-Direktion verantwortlich für den Betrieb und die Unterhaltung landeseigener wasserwirtschaftlicher Anlagen. Der Landesbetrieb sieht sich in einer Vorbildrolle hinsichtlich der WRRL-Umsetzung an seinen eigenen Gewässern, begegnet dabei aber wie viele andere Akteure auch immer wieder großen Herausforderungen. Allen voran bestehende Nutzungen, die Flächenknappheit und auch Fachkräftemangel erschweren das Fortkommen.
Künstliche und vom Menschen in früheren Jahrzehnten besonders stark veränderte – begradigte, kanalisierte, aufgestaute, befestigte – Gewässer erweisen sich zudem unter den sich wandelnden klimatischen Rahmenbedingungen in der Gewässerunterhaltung als besonders arbeitsintensiv und empfindlich. „Sie leiden auch am meisten unter den Auswirkungen des Klimawandels“, so Drosten. Naturnahe Gewässer dagegen würden sich resilienter zeigen – und erforderten auch deutlich geringeren Pflegeeinsatz. „Beim Winterhochwasser 2023/2024 konnten wir ganz klar feststellen, dass uns die naturnahen Gewässer bei der Bewältigung der Wassermassen deutlich weniger Aufwand bereitet haben. Daher unser Fazit: Naturnahe Gewässerlandschaften sind günstiger für die Bewältigung von Hochwasserlagen“, betont der NLWKN-Fachmann.
22 Millionen Euro für naturnahe Entwicklungsvorhaben
Profitieren soll von all diesen Anstrengungen neben der Natur und dem Hochwasserschutz am Ende auch das Klima, denn: „Naturnahe gewässerbegleitende Niedermoore und Auenwälder besitzen durch den Kohlenstoffrückhalt der Böden und der Vegetation ein hohes Potenzial zum Treibhausrückhalt. Zudem wird durch die Produktion von Biomasse der Atmosphäre CO2 entzogen“, unterstreicht Nadja Amaro, die die Leitung des KEG übernommen hat.
Im Interesse des Natur- und Hochwasserschutzes gehe es nun insgesamt darum, die Widerstandsfähigkeit der Fließgewässer im Hinblick auf die Klimafolgenanpassung zu erhöhen, betont Petra Heidebroek, Leiterin des Geschäftsbereichs landesweiter Naturschutz im NLWKN: „Das erreichen wir durch die Entwicklung naturnäherer Zustände der Gewässer und ihrer Auen. Sie dient auch dem Aufbau eines funktionstüchtigen landesweiten Biotopverbunds, bei dem die Fließgewässer ein wichtiges Bindeglied zwischen den Naturräumen bilden. Die Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen, Lebensräumen und Arten wird dadurch maßgeblich verbessert.“
NLWKN-Jahresbericht 2024: Studie beleuchtet Erfolgsfaktoren und Hemmnisse bei Revitalisierung von Gewässern
Das Thema Fließgewässer bildet insgesamt einen der Schwerpunkte im NLWKN-Jahresbericht 2024. Um zu wissen, ob man mit den bisher eingeleiteten Schritten auf dem richtigen Weg ist, haben NLWKN-Biologen und Hydrologen etwa in einer im Rahmen des Jahresberichts vorgestellten Studie zahlreiche Revitalisierungsprojekte an Flüssen und Bächen in Niedersachsen überprüft. Das Ergebnis: Insbesondere strukturärmere Gewässerabschnitte lassen sich relativ leicht durch Steigerungen des Strukturreichtums, der Dynamik und der Strömungsvielfalt so aufwerten, dass sich gewässertypische Arten wieder ansiedeln können. Gerade Projekte auf längerer Strecke zeigen dabei enorme Entwicklungspotenziale – wenn sie mit einer schonenden Gewässerunterhaltung und der Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit einhergehen.
Der NLWKN-Jahresbericht 2024 klärt aber auch über umgesetzte Vorhaben, aktuelle Entwicklungen und bestehende Herausforderungen in anderen Fachbereichen des Landesbetriebs auf. „Zusammen mit einem Kompendium an Zahlen aus Wasserwirtschaft und Naturschutz gestattet er einen schnellen Überblick über das breite Spektrum unserer Aufgaben in Niedersachsen. Vom neuen Online-Angebot einer „Querbauwerksdatenbank Niedersachsen“ über Beiträge zu unseren Radonmesskampagnen im Land, den Strahlenschutz-Praxisschulungen für Einsatzkräfte bis hin zu diversen LIFE-Projekten – um nur einige zu nennen“, so NLWKN-Direktorin Rickmeyer. „Für die in 2024 gemeinsam erfolgreich bewältigten Herausforderungen und ihren Einsatz gilt mein Dank allen Mitarbeitenden des NLWKN. Besonders bedanken möchte ich mich auch bei Minister Christian Meyer, der unsere Arbeit in so vielfältiger Weise unterstützt – nicht zuletzt durch die Bewilligung von Stellen oder Entfristungen in so wichtigen Aufgabenbereichen wie dem Küsten-, Hochwasser- und auch dem Naturschutz. Nur so können wir die wachsenden Herausforderungen unserer Zeit bewältigen!“
Den NLWKN-Jahresbericht 2024 ist online unter www.nlwkn.niedersachsen.de/jb24 zu finden.
Bildmotive und weitere Informationen zu den vorgestellten Themen stehen über nachfolgendem Link als Download zur Verfügung:
https://nlwkn.hannit-share.de/index.php/s/DTF3dyysWZE2D2m
Passwort: NLWKNJB2025
Die Fotos sind unter Angabe der Quellen zur einmaligen Veröffentlichung im Rahmen der Berichterstattung über den NLWKN freigegeben.
 Bildrechte: NLWKN
Bildrechte: NLWKNArtikel-Informationen
erstellt am:
10.04.2025
Ansprechpartner/in:
NLWKN Pressestelle
Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
Göttinger Chaussee 76a / Am Sportplatz 23
30453 Hannover / 26506 Norden
Tel: +49 (0)511 3034-3322 sowie +49 (0)4931/ 947 -173 und +49 (0)4931/ 947 -181
Fax: +49 (0)4931/947 - 222